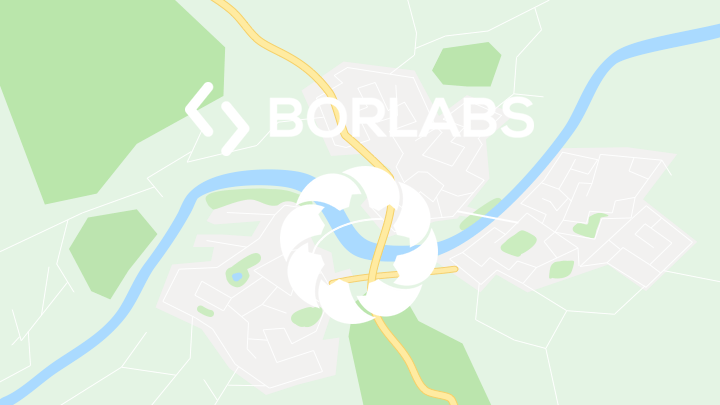Jeder gute Betrieb ist ein Ort, an dem Wertschöpfung entsteht. Aus der Kombination der Produktionsfaktoren Wissen, Können, Zeit, Material und Energie entstehen Produkte und Dienstleistungen. In unseren Worten: „Aus der sinnlosen Ursuppe des zufällig Verteilten schaffen Sie eine wirkmächtige Institution für Wohlfahrt, Mehrwert und Wertschöpfung. Sie gestalten einen Ort, dessen Lösungen die Menschen als wertvoll betrachten.“
Immer mehr Unternehmen beginnen darüber nachzudenken, ihren Betrieb nachhaltiger zu gestalten. Die Spanne reicht von sehr konkreten Fragen wie dem Essensangebot in der Kantine bis hin zu strategischen Überlegungen.
Versuchen wir eine betriebliche Definition von nachhaltiger Gestaltung eines Betriebes.
Ein an den Prinzipien der Nachhaltigkeit orientierter Betrieb schafft Produkte und Dienstleistungen, die die Welt ein wenig besser machen und die der Welt keinen Schaden zufügen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man mit endlichen Ressourcen hantiert, zumindest Arbeitszeit, Material und Energie (sofern aus endlichen Quellen) sind endliche Ressourcen.
Wählen wir den systemischen Ansatz und gliedern wir den Betrieb in Prozesse.

Der Mehrwert
Die Errichtung, Ausstattung und die Erhaltung des Betriebes vom Bau, Umbau und Ausbau, den Erweiterungen, Modernisierungen und Sanierungen der Betriebsgebäude und dessen betrieblicher Infrastruktur, vom Bürostuhl und den Computern bis zur Ausstattung der Seminarräume, der Werkstätten, der Produktionshallen, der Küche und all dem, was ein Betrieb für seinen Betrieb benötigt.

Die Wertschöpfung
Betriebliche Prozesse umfassen die Führung und das Management – von den Zielen bis zum Einkauf, die Organisation der Arbeit, die Versorgung mit Energie und Material, die Öffentlichkeitsarbeit und die Buchführung, die Ausbildung und Fortbildung der Mitarbeiter, das initiieren von Verbesserungen und Innovationen und all das, was den Wertschöpfungsprozess effizient und effektiv gestalten hilft.

Die Wohlfahrt*
Dieser Prozess ist ein offener Prozess, denn auf der einen Seite bekommt der Betrieb Input, zum Beispiel Kundenanforderungen, das Wissen und Können der Mitarbeiter, die Anlieferung des Materials. Auf der anderen Seite verlassen die Lösungen des Betriebes, seine Produkte und Dienstleistungen, das Haus.
Die nachhaltige Gestaltung eines Unternehmens – und es ist gleich, von welcher Art Unternehmen wir sprechen – umfasst alle drei Prozessketten: den Mehrwert, die Wertschöpfung und die Wohlfahrt.
Unsere Erfahrung ist: Beginnen Sie im Idealfall bei dem Konzept und der Planung der Wohlfahrt. Welche Lösungen bietet Ihr Unternehmen? Wem bieten Sie Ihre Lösungen an? Was ist der konkrete Beitrag Ihrer Produkte und Dienstleistungen, dass die Welt ein wenig besser wird.
Beispiel Holzbau-Betrieb: Ein mittelständischer Holzbau-Betrieb bezieht seine Rohstoffe – vorzugsweise Holz – aus der Region. Damit bleiben die Transportwege kurz und die Wertschöpfung bleibt in der Region. Der Betrieb beschäftigt ortsansässige Mitarbeiter*innen, bildet aus und verkauft seine Produkte – Häuser aus Holz – in der Region. Das dem Wald entnommene Holz bindet das CO2 für lange Zeit, im Wald wachsen neue Bäume nach.
Der Betrieb bezahlt seine Mitarbeiter und Lieferanten anständig und der Betrieb wächst organisch. Einen Großteil der Energie für die Produktion bezieht der Betrieb aus der hauseigenen Photovoltaik und aus den Holzabfällen. Das ist schon ziemlich nachhaltig.
Der nachhaltige Mehrwert? Die Familie bezieht ihr nach ökologischen Kriterien errichtetes Holzhaus. Wie sie dort ihren Alltag gestaltet, entzieht sich der Einflussnahme des Holzbau-Betriebes. Ob sich die Familie drei Autos anschafft, Tag und Nacht überall Licht brennen und das Wasser laufen lässt, eine (in einem ökologischen Holzhaus unnötige) Klimaanlage von April bis Oktober durchlaufen lässt … oder eben all das nicht tut, sondern viel mit dem Fahrrad fährt und auf dem Wochenmarkt einkauft, all das ist ihre Entscheidung. Doch egal wie, zumindest ist das Haus aus regionalem Holz nach allen Regeln der Kunst errichtet.
Beispiel Bildungsanbieter: Der Bildungsanbieter bietet in seinem Haus Seminare, Workshops, Klausuren, Veranstaltungen, Open-Stages, World-Cafés und viele Veranstaltungsformen mehr an zu dem Themenkomplex „Nachhaltigkeit im Alltag“. Die Teilnehmer*innen kommen aus dem deutschsprachigen Raum, die Referent*innen ebenfalls. Der Bildungsanbieter bietet eine Vollverpflegung und Übernachtungsmöglichkeiten je nach Geschmack und Geldbeutel – Essen aus regionalen und saisonalen Zutaten von Bauernhöfen und Lieferanten aus der Region und übernachtet wird vom Einzelzimmer bis zur Gruppenunterkunft mit Heuhotel.
Der Bildungsanbieter bezahlt seine Mitarbeiter*innen und Referent*innen fair und gestaltet sein Geschäftsmodell so, dass er möglichst wenig Fördermittel für seine Arbeit benötigt. Denn Schulden machen ist nicht nachhaltig. Die Energie kommt aus der Photovoltaik und aus einer Erdwärmepumpe, die Seminargebäude sind mit nachwachsenden Rohstoffen gebaut, alles ist barrierefrei zugänglich, die Anreise und Abreise der Gäste ist leicht mit der Bahn möglich
Der nachhaltige Mehrwert? Auf der einen Seite kommen die Teilnehmer*innen in das Seminar hinein, dort erfahren sie etwas über Nachhaltigkeit im Alltag und dieses Wissen und Können setzen sie nach dem Seminar im Alltag ihrer Lebenspraxis um. Der Bildungsanbieter kann sich einzig darauf konzentrieren, qualitätvolles Wissen und konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Ob und wie die Teilnehmer*innen das nachdem Seminar anpacken, entzieht sich der Gestaltungsmöglichkeit des Bildungsanbieters.
Unsere Praxis-Checkliste für die nachhaltige Gestaltung Ihres Unternehmens
- Erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeiter*innen in Ihrem Unternehmen ein Leitbild. Beziehen Sie dort ausdrücklich die Aspekte der Nachhaltigkeit ein, die für Ihr Unternehmen von Belang sind. Hierbei ist ein dezidierter Blick in die 17 SDGs sehr sinnvoll. Sie werden sehen: je nach Bedingungslage Ihres Unternehmens bilden sich hier Schwerpunkte heraus.
- Definieren Sie Ihre Ziele und begründen Sie diese – Was bieten wir an? Wem bieten wir an? Wie bieten wir an? Warum sind unsere Lösungen besser? Wo ist der Mehrwert – für unsere Kunden UND für unser Unternehmen?
- Schreiben Sie ein sauberes, klares, konkretes Konzept – Wie soll das nachhaltige Wirtschaften in unserem Unternehmen genau funktionieren? Was spielt mit was zusammen? Welche Kapazitäten brauchen wir? Wie halten wir uns flexibel und gleichermaßen verbindlich? Wie begünstigen wir Dauerhaftigkeit? Blicken Sie objektiv auf Zahlen! Absatz, Umsatz, Auslastung, Break-Even (Gewinnschwelle), Kosten, Investitionen.
- Planen Sie robust und umsichtig – Was muss bis wann fertig sein? Haben wir Puffer? Wie lautet der Plan B (und der Plan C). Wie lange dauert es, bis ein Prozess wirklich funktioniert?
- Holen Sie sich Partner an Bord – Wer tickt wie wir? Wer ist der Nachhaltigkeit verpflichtet? Mit wem wollen wir wachsen? Wer kann verlässlich liefern?
- Fangen Sie an: das beste Konzept und der beste Plan beweisen sich erst in der Praxis. Ja, Sie werden Fehler machen. Ja, Sie werden dazulernen. Ja, nicht alles war zu Ende gedacht. Ja, Sie werden Überraschungen erleben. Ja, wir bleiben dran. Und Ja, wir haben Freude an dem, was wir und wie wir es tun.
- Zum Schluss: Holen Sie sich bei allen Arbeitsschritten professionelle Hilfe an Bord, so arbeiten Sie verlässlich „state-of-the-art“.
Die skizzierte Praxis-Checkliste illustriert beispielhaft den Prozess der nachhaltigen Gestaltung Ihres Unternehmens. Selbstverständlich passen wir die Checkliste den spezifischen Gegebenheiten und Reifegraden Ihres Unternehmens an.
Interesse? Melden Sie sich einfach und dann besprechen wir Ihr Projekt „Unternehmen nachhaltig gestalten“.
Herzlich willkommen im Club der klaren Denker und kraftvollen Macher,
Ihre
Anja & Stefan Theßenvitz
*Verzeihen Sie das altertümliche Wort Wohlfahrt. Wohlfahrt – aus dem mittelhochdeutschen wolvarn kommend, ist das Bemühen um die Deckung der Bedürfnisse von Menschen und die Sicherung deren Lebensstandards. Wohlfahrt ist auch die planmäßig ausgeübte Sorge für das Gemeinwohl der Menschen, die Sorge für deren Gesundheit und deren sittliches und wirtschaftliches Wohl, deren Erziehung zu besseren Menschen und die Vorbeugung vor moralischem, körperlichem oder materiellem Verfall. Aus diesem Grundgedanken speist sich die Betriebswirtschaft; diese ist eine Sozialwissenschaft und bedient sich verschiedener Werkzeuge, um Mehrwert, Wertschöpfung und Wohlfahrt zu gestalten. Allein die Verpflichtung zur Wohlfahrt führt dazu, bestmögliche Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die keinen Schaden anrichten und über den Gebrauchswert hinaus auch einen Beitrag für eine bessere Gesellschaft leisten. Das kann man auch nachhaltiges Wirtschaften nennen.